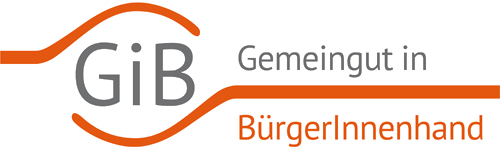Bild: CC0 Creative Commons
Von Uli Scholz und Herbert Storn
Am 25. Juli erschien in der Frankfurter Rundschau, der Berliner Zeitung und dem Kölner Stadtanzeiger (Dumont-Gruppe) ein weitgehend identischer Kommentar von Markus Sievers zur Schuldenbremse. Erfreulich, weil die erbärmliche Argumentationsfassade der Schuldenbremse und ihre verheerenden Auswirkungen auf die öffentliche Infrastruktur deutlich werden. Da aber in dem Kommentar von einer Initiative zur „Schuldenbremse“ die Rede war, musste diese Initiative erstmal gefunden werden. Auf der Homepage der Rosa-Luxemburg-Stiftung, der Gruppe „Alternative Wirtschaftspolitik“ und bei Axel Troost kann man fündig werden. Leider dient das dort veröffentlichte Papier [1] hauptsächlich der Verteidigung und Rechtfertigung der Berliner „Schulbauoffensive“ durch „ÖÖP“, das kein ÖPP sein darf, weil ein solches in der Koalitionsvereinbarung ausgeschlossen wurde. Das hat der Kommentator Sievers komplett unter den Tisch fallen lassen, warum auch immer.
In welcher Situation wird das Papier veröffentlicht?
Das Papier wird in einer Situation vorgelegt, wo in Berlin durch eine Volksinitiative von Gemeingut in BürgerInnenhand und mit Unterstützung u. a. durch die GEW Anhörungen in den jeweils zuständigen Parlamentsausschüssen erzwungen wurden, die demnächst stattfinden werden. Das Papier schlägt sich auf die Seite des Senats, ist in diesem Sinn also parteilich.
Mit dem Senatsmodell liege kein Verstoß gegen die Koalitionsvereinbarung zu ÖPP vor, es werde damit kein Schattenhaushalt eingeführt, es liege kein Verstoß gegen die „Schuldenbremse“ nach dem Grundgesetz vor.
Das Papier ist ärgerlich, weil es linke Kräfte in einen Konflikt untereinander zieht, der die gemeinsamen Anstrengungen gegen das Kreditaufnahmeverbot durch die „Schuldenbremse“ und die EU-Vorschriften (Maastrichter Verträge, Fiskalpakt, …) stark in den Hintergrund treten lässt, statt den Kampf gegen diese „Rutschbahn in die Privatisierung“ aufzunehmen.
Besonders, wenn man aus den Medien erfahren muss, dass im Hintergrund vom Berliner Senat bereits die Beratung des ehemaligen Vorsitzenden der Lobby-Organisation ÖPP-Deutschland-AG in Anspruch genommen wird.
Ärgerlich ist auch, dass unter der Überschrift „Mehr Transparenz wagen!“ die Kritik der Intransparenz des Berliner Vorhabens mit „Transparenzklauseln“ als „vertrauensbildende Maßnahmen der Politik“ ruhiggestellt wird – während bisher alle strukturellen Informationen zu dem Senatsprojekt unter erheblichen Anstrengungen und durch investigative Maßnahmen zutage befördert werden mussten, bis hin zur Sammlung von über 30.000 Unterschriften für eine Volksinitiative zu offiziellen Anhörungen! (Der Berliner Wassertisch lässt grüßen!)
Einschätzung der Argumentation
Die Autor/inn/en des Standpunktpapiers bestätigen eine Reihe von Argumenten, die Gemeingut in Bürgerinnenhand in die Diskussion eingebracht hat. Beispiel: „Die rechtliche Konstruktion ist identisch mit ÖPP-Mietkaufmodellen.“ Die Autoren zeigen klar auf, wie die Geheimhaltung der Geschäfte und Verträge landeseigener Unternehmen sichergestellt und Transparenz unmöglich gemacht wird [2]. Sie benennen die Übertragung von Schulimmobilien an die HOWOGE als formelle Privatisierung und bestätigen implizit, dass die „Eigentumsrechte an den Gebäuden“ für Jahrzehnte an die Wohnungsbau-GmbH übergehen.
Neue privatisierungskritische Argumente bringen die Autor/inn/en allerdings nicht ein, vielmehr versuchen sie, die bekannten Argumente zu widerlegen. Dies geschieht erstens durch die Wahl des Gegenstands, nämlich Berlins, zweitens durch eine enge kameralistische Sichtweise und drittens durch Beschönigung der mit der Privatisierung verbundenen Risiken für den Landeshaushalt. Viertens und vor allem aber durch eine konsequente Weigerung, die Ursachen der Schulbauschwäche Berlins in den Fokus zu nehmen.
Zu Erstens: In Berlin wurde seit circa 1995 erheblich weniger investiert und erheblich weniger Personal in der öffentlichen Verwaltung vorgehalten als in vergleichbaren Großstädten. Gemessen an den privaten Haushaltseinkommen und den Steuereinnahmen ist Berlin eine der ärmsten Regionen. [3] Demgegenüber wächst die Bevölkerung und mehr noch die Zahl schulpflichtiger Kinder verglichen mit anderen Armutsregionen sehr schnell. Den Autor/inn/en muss widersprochen werden, wenn sie hieraus ableiten, Berlin würde sich als „Fallbeispiel“ anbieten. Im Gegenteil, die Fakten sprechen eindeutig für eine regional verschärfte Schulbauschwäche. Hinzu kommt, dass mit ähnlichen Situationen in einigen Kommunen in Nordrhein-Westfalen ganz anders umgegangen wird als in Berlin. Das Standpunktpapier wird anderen Bundesländern – der Anspruch wird im Titel genannt – schon bei der Wahl des „Fallbeispiels“ nicht gerecht.
Zu Zweitens. Das Argument, „dass der massive Ausgabebedarf Berlins … nicht aus dem Kernhaushalt gedeckt werden kann“, wäre nur dann vertretbar, wenn die Schuldenregel des Grundgesetzes ohne Einschränkung durch einen Konjunkturfaktor schon jetzt gelten würde. Das wird aber – wenn Berlin bis dahin so weiterregiert wird – erst ab 2020 der Fall sein. Dementsprechend belegen die Autor/inn/en ihre Behauptung auch nicht, sondern setzen sie als „evident“ voraus. Ohne Nachweis bleibt die damit aufgestellte These, ohne formelle Privatisierung würden entweder nicht genügend Schulplätze geschaffen oder es müssten andere notwendige Ausgaben bei Personal oder Infrastruktur noch weiter gekürzt werden. Leider ermuntert diese These nicht gerade zur Prüfung von Alternativen. Zudem behaupten die Autor/inn/en, die „Kritiker“ der Privatisierung von Schulen würden „die Möglichkeit der Forfaitierung, also des Weiterverkaufs der Forderung, mit der Privatisierung von öffentlichem Eigentum“ verwechseln, wie sie bei der Staatsverschuldung gang und gäbe ist. Richtig ist dagegen, dass die Schulträger in Berlin mit den einredefreien Verträgen ihre Verantwortung für nachhaltiges Planen und Bauen an die HOWOGE (und die an die Generalplaner und -unternehmer) abgeben sollen, was bei Haushaltsfinanzierung über Landesanleihen eben gerade nicht der Fall wäre.
Zu Drittens. Das Risiko einer künftigen Haushaltsmehrbelastung im Vergleich zu konventioneller Haushaltsfinanzierung als beherrschbar darzustellen, ist in einer konsistenten Argumentation gar nicht möglich. Zu den krassen Widersprüchen, in die sich die Autor/inn/en an diesem springenden Punkt verstricken, später im Detail.
Zu Viertens. Berlin konnte jüngst eine Summe von circa 500 Millionen Euro weder verplanen noch investieren, die im Haushalt 2017 für Schulbauinvestitionen eingeplant worden waren. Dies entspricht in etwa der Fortschreibung der im November 2017 vorgestellten Ergebnisse der Kurzstudie von Gemeingut in Bürgerinnenhand zur möglichen Höhe von Schulbauinvestitionen. [4] In ähnlicher Höhe nahm Berlin Ende 2017 eine Sondertilgung seiner Schulden vor. [5] Die Zahlungsmittel waren übrig. In Berlin liegt keine Liquiditäts-, sondern eine spezifische Schulbauschwäche vor, infolge Personalmangels in öffentlichen Verwaltungen und der regionalen Bauwirtschaft.
Berlin hat das, was andere Gebietskörperschaften auch getan haben (die offizielle Politik des „schlanken Staats“ bzw. des „Magerstaates“), besonders extensiv betrieben.
Den Autor/inn/en des Papiers ist zu danken, dass sie den Unsinn der grundgesetzlichen Schuldenregel noch einmal anhand aktueller Entwicklungen belegt haben.
Die Schuldenregel hat aber nur am Rande mit der Berliner Personalmangelsituation zu tun. Diese wurde zwar seit 2015 breit öffentlich diskutiert, nachdem die finanziellen Mittel des damaligen Sondervermögens Infrastruktur der wachsenden Stadt (SIWA) Jahr für Jahr nur zu Bruchteilen ausgegeben werden konnten, aber eingestandenermaßen war es nie die Absicht des Senats, dieses Problem zu lösen, sondern eine Lösung für mehr Schulplätze zu präsentieren. Der Staatssekretär in der SenBJF, Mark Rackles: „Mich interessierte zu keinem Zeitpunkt das Problem (schon gar nicht dessen historisch-politische Herleitung) – mich interessiert immer nur die Lösung!“ [6] Dementsprechend musste der Rat der Bürgermeister das 2017 vorgelegte „Personalpolitische Aktionsprogramm“ des Senats als „bei weitem nicht ausreichend“ qualifizieren [7] und Ergänzungen vorschlagen, die gemessen an den tatsächlichen Herausforderungen (mehrere Hundert Planer, viele Tausende Auszubildende und Arbeitende am Bau) allerdings ebenfalls unzureichend sind. Die vom Senat präsentierte Lösung (Bau und Sanierung der Grundschulen in zentraler Verantwortung der SenStadtWohn – Übertragung praktisch aller Standorte für neue weiterführende Schulen ins Privatrecht bei der HOWOGE) ist folglich nur eine Teillösung, bei der die volle staatliche Verantwortung für den Bau und die Sanierung nur noch für die Grundschulen vorgesehen ist.
Aus Sicht der verantwortlichen Politiker/innen ist die Verschiebung eines Teils des Problems zur HOWOGE durchaus sinnvoll, denn der damit verbundene Verzicht auf eine geeignete politische Lösung des Personalproblems wird ihnen über kurz oder lang wie eine Prophezeiung Recht geben, die sich von selbst erfüllt. Der (Personal)Politikverzicht wird die Freiheitsgrade absehbar so weit verringern, dass eine Privatisierung wie vom Senat geplant in einigen Jahren tatsächlich als alternativlos erscheinen kann. So würde ein personalpolitisches Programm die betroffenen Teilarbeitsmärkte erst in frühestens drei Jahren spürbar entlasten, so wird die Schuldenregel 2020 auch in Berlin voll zur Anwendung kommen und die Liquidität begrenzen, so wächst der Sanierungsstau Tag für Tag, weil die HOWOGE mit ihren vorhandenen Strukturen noch gar nicht in die Planung einsteigen kann.
Angesichts des miserablen Gebäudezustands der Schulen spricht vieles dafür, dass die fast zwei Jahre, die der Senat bisher vertan hat, eigentlich doppelt oder dreifach gezählt werden müssten.
Unberechenbare Haushaltsmehrbelastung
Nachdem die Auswirkungen der „Schuldenbremsen“-Politik und einer falschen Haushalts“konsolidierung“ zu Recht kritisiert worden sind, scheinen die Autor/inn/en alles zuvor Gesagte zu vergessen und zaubern aus dem in Vorbereitung befindlichen Berliner ÖPP-Modell ein ÖÖP-Konstrukt, das sie dann zur bundesweiten Nachahmung und als Ausweg aus der „Schuldenbremse“ propagieren.
Von „Erprobung“ – wie es die Autor/inn/en des Standpunktpapiers (S. 5) nennen – kann übrigens keine Rede sein, wenn ein derart großes Projekt, das sogar das bisher größte ÖPP-Projekt im Landkreis Offenbach übertrifft, für 25 Jahre und länger auf die Schiene gesetzt werden sollte.
Schon der „entscheidende Unterschied zu ÖPP“, „dass private Investoren außen vor bleiben“, kann nur Kopfschütteln hervorrufen.
Richtig ist das Gegenteil: Gerade sie sollen den Schulbau finanzieren, denn die HOWOGE soll die Kredite am Markt aufnehmen. Damit nicht genug. Die von öffentlichen Förderbanken angebotenen Infrastrukturfinanzierungen sind aufgrund der zwingenden Bankdurchleitung immer an die Kreditkonditionen der Hausbank gebunden, die für den Kredit haftet. Das per „Einredeverzicht“ risikolos gestellte Finanzprodukt ist ja das, worauf private Banken und Fonds scharf sind, und was mit Hilfe privater Berater wie Bernward Kulle (vormals ÖPP-Deutschland AG, jetzt PD Berater der öffentlichen Hand) oder PricewaterhouseCoopers hinter den Kulissen vorbereitet wird.
Außerdem soll nicht „die HoWoGe die Schulen sanieren“ (Standpunktpapier S. 5), sondern sie soll lediglich einen Generalunternehmer beauftragen, mit Subunternehmen zu bauen, zu sanieren und die Bewirtschaftung zu übernehmen. Denn die HoWoGe hat gar nicht das Personal, schließlich schafft sie ja schon den Nachholbedarf im Wohnungsbau nicht.
Auch die anderen genannten Merkmale sind Merkmale von ÖPP. Zu Recht schreiben die Autor/inn/en: „Die rechtliche Konstruktion ist identisch mit sogenannten ÖPP-Mietkaufmodellen.“ (S. 5)
Auch in Frankfurt am Main wurde bei einem ÖPP-Projekt (IGS-West) dessen Charakter vorübergehend geleugnet, indem es als „Mietkaufmodell“ bezeichnet wurde, was sich aber dank einer kritischen Öffentlichkeit nicht lange halten ließ, bevor zugegeben wurde, dass es ein weiteres ÖPP-Projekt sei.
„Der Hauptnachteil dieses Modell ist die Zinskostendifferenz““ (S. 5). Das ist aber beileibe nicht der einzige gravierende Nachteil. Entscheidend sind neben den Beraterkosten hier vor allem die einseitige Risikoverlagerung auf Staat und Kommune durch den schon genannten Einredeverzicht und die lange Laufzeit.
Durch den Einredeverzicht bleibt das volle Risiko bei den Schulträgern, die HOWOGE muss keinerlei Risiken tragen, und so wird die Schwelle zur materiellen Privatisierung übertreten. Privatisierungskritiker/innen weisen auf eine zusätzliche Privatisierung von Steuermitteln hin, nämlich sehr große Haushaltsrisiken, weil nicht nur der Schulbau (und dabei vor allem im maroden Bestand) im Vergleich zum Wohnungsbau erheblich höhere Finanzierungsrisiken beinhaltet, sondern das HOWOGE-Modell des Senats auch noch jeden denkbaren Anreiz zum nachhaltigen Planen für die Wohnungsbaugesellschaft ausschließt.
Es grenzt schon an polemische Verzerrung, dass die Autor/inn/en des Standpunktpapiers den Hinweis darauf als Verwechslung von Haushaltsinstrumenten hinstellen. Die genannten Risiken sind rein kameralistisch zwar nicht darstellbar, auch weil die Mehrkosten nicht exakt prognostiziert werden können. Dass sie in aller Regel aber eintreten und von Ländern beziehungsweise Kommunen dann auch beglichen werden müssen, zeigt eine lange Reihe von Erfahrungen mit ÖÖP/ÖPP-Projekten im Schulbau (Frankfurt am Main, Landkreis Offenbach, Magdeburg, …) Die Berliner DEGEWO-Schulen, für die Jahrzehnte lang Miete gezahlt werden musste, obwohl sie nicht mehr nutzbar waren, sind da nur der Anfang gewesen.
Im Übrigen bestätigen auch die AutorInnen, dass es zu solchen „Konflikten und sogar Rechtsstreitigkeiten“ kommen kann (S. 6). Wie ein „kluges Beteiligungsmanagement des Landes als Eigentümerin der HoWoGe“ diese Streitigkeiten vermeiden sollte, erschließt sich durch die allenthalben beobachtbare Praxis von „Beteiligungsmanagements“ jedenfalls nicht. Und dazu muss man nicht einmal den Hauptstadtflughafen heranziehen.
Es ist fragwürdig genug, das ÖÖP-Modell des Senats, ein ÖPP-Modell mit allen nachteiligen Privatisierungsaspekten, mit dem Bau und der Sanierung von Schulen in Eigenregie auf eine Ebene zu ziehen. Dies aber mit Binsenweisheiten („Gesellschaftliche Mehrheiten entscheiden über Privatisierungen“ – Standpunktpapier S. 6) zu begründen, ist schon mehr als Polemik.
Transparenz ? In Berlin immer nur auf Druck?!
Besonders pikant und wirklichkeitsfremd wird es unter der Überschrift „Mehr Transparenz wagen!“ Die Autor/inn/en beschreiben zunächst zutreffend die brutale Transparenzverweigerung der ÖPP-Praxis:
„Die Steuerung von Landesbeteiligungen, egal ob privatrechtlich oder öffentlich-rechtlich aufgestellt, erfolgt über die gesellschaftsrechtlich vorgesehenen Unternehmensgremien (Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung). Vertrauliche Unternehmensinformationen (Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse) erhält das Parlament nur zur Einsichtnahme im Datenraum. Notizen dürfen gemacht werden, diese verbleiben aber vor Ort und werden nur für die jeweilige Sitzung des zuständigen Beteiligungsausschusses des Abgeordnetenhauses ausgeteilt, der dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit tagt. Das Management der Unternehmen ist darüber hinaus nicht automatisch weisungsgebunden und kann die Herausgabe von Informationen verweigern bzw. verzögern, da es zuerst einmal nur die gesellschaftsrechtlichen Vorgaben erfüllen muss.“ (S. 7)
Aber dann kommt’s dicke:
„In einem ÖÖP-Modell stellt sich die Vertraulichkeit jedoch anders dar als beispielsweise bei der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg, die im Wettbewerb mit anderen Unternehmen steht.“ (S. 7)
Man reibt sich verwundert die Augen: Die HoWoGe steht nicht im Wettbewerb mit anderen Wohnungsbauunternehmen?
Die Autor/inn/en orientieren zwar auf „ein kluges Beteiligungsmanagement“ bei der Wohnungsbaugesellschaft HOWOGE sowie auf „Transparenzklauseln“ in Verwaltungsvorschriften und Verträgen.
Dem steht jedoch schon eine so simple Vorschrift wie das Berliner Informationsfreiheitsgesetz entgegen (§ 7 Schutz des Betriebs- und Geschäftsgeheimnisses), das Transparenz im Sinne der Autor/inn/en gerade ausschließt. Zudem folgt die aktuelle Rechtsprechung auch den Vorschriften des HGB und des GmbHG zur Geheimhaltung getreulich wie eh und je. [8] Die Vertreter des Eigentümers sind in dieser Eigenschaft nun einmal der GmbH verpflichtet und machen sich durch anderweitiges Handeln strafbar. Angesichts dieser Rechtslage erklären die Autor/inn/en des Standpunktpapiers leider auch nicht, wie das von der Partei Die Linke geforderte Privatisierungsverbot in der Landesverfassung überhaupt justiziabel sein könnte.
Zumindest die damals Beteiligten sollte die Erinnerung an den „massiven Druck eines erfolgreichen Volksbegehrens“ zur Offenlegung der Verträge zur Teilprivatisierung der Berliner Wasserbetriebe (S. 7) ahnen lassen, welche Hürden bei der Transparenz zu überwinden sind.
Die „eierlegende Wollmilch-Sau“
„ÖÖP ist grundgesetzkonform“ ist der vorletzte Absatz überschrieben. Und weiter:
„Die Kreditaufnahme bei der HoWoGe stellt keine Umgehung der Schuldenbremse dar, vielmehr steht sie vollkommen im Einklang mit den rechtlichen Vorgaben des Grundgesetzes. Aber die negativen Konsequenzen der Schuldenbremse werden neutralisiert oder wenigstens abgemildert. Es ist sinnvoll, die Nutzung des Spielraums, den die Regelung im Grundgesetz bietet, politisch offensiv zu kommunizieren. Denn die Vorteile überwiegen. Durch die vorgeschlagenen ÖÖP-Regelungen können in Berlin trotz Schuldenbremse Zukunftsinvestitionen in großem Stil realisiert werden.“
Die Begründung ist abenteuerlich:
„Auch kommt es im Mietkaufmodell langfristig nicht zu einem Anstieg der Verschuldung Berlins, da die Kredite der HoWoGe innerhalb von 25 Jahren zurückgezahlt werden müssen – dies steht im Einklang mit dem wichtigsten Ziel der Schuldenbremse. Da die reale Nutzungsdauer weit über dem bilanziellen Abschreibungszeitraum liegt, steigt damit auch das Nettovermögen des Landes. Mit dem ÖÖP-Modell entsteht kein Schattenhaushalt und langfristig auch keine zusätzliche Verschuldung des Landes, die HoWoGe als öffentliches Unternehmen eingeschlossen. Die Kreditaufnahme der HoWoGe wird vielmehr weitgehend an den Lebenszyklus der Investitionen gekoppelt.“
Damit wären ja alle staatlichen Kreditaufnahmen in Form von Tilgungsdarlehen und alle zeitlich festgelegten Anleihen, mit denen Investitionen getätigt werden, von der „Schuldenbremse“ gar nicht betroffen. Die Infrastruktur wäre gerettet! Und es gäbe nur noch das Problem der Personalkosten!
Da bleibt nur Kopfschütteln …
Bleibt „leider“ noch die EU, die einen Strich durch die Rechnung machen könnte (S. 8,9). Also weiter ungedeckte Schecks für das Senats-Modell, denn dass aus dem Kernhaushalt der Nachholbedarf nicht gedeckt werden kann (S. 2 unten), bedeutet nichts anderes als: aus Schattenhaushalten erst recht nicht!
Den Magerstaat endlich überwinden!
Das Beispiel Berlin zeigt eindringlich, dass wir unweigerlich bei der Privatisierung von Gemeingütern landen, solange das Problem des Personalmangels in öffentlichen Verwaltungen und der regionalen Bauwirtschaft nicht gelöst wird. Es ist Zeit für eine Kehrtwende, denn noch sind Alternativen vorhanden. So darf Berlin – und durfte seit 2016 sehr wohl – zu historisch günstigsten Konditionen neue Schulden aufnehmen, müsste das aber noch nicht einmal, um personalpolitisch voranzukommen. Die vorhandene Liquidität bietet sich außerdem an, um einen neuen staatlichen Baubetrieb mit entsprechendem Eigenkapital auszustatten und ein groß angelegtes Ausbildungsprogramm durch ein Praxisprogramm zu ergänzen.
In einigen Kommunen wie Frankfurt am Main werden seit der Kommunalwahl von 2016 auch schon ansatzweise Alternativen praktiziert, obwohl auch hier die Korrektur einer Magerstaat-Politik der Vergangenheit eben dauert:
- ausreichend Finanzmittel für Bau- und Finanzierung von Schulen bereitstellen
- dafür sorgen, dass diese Finanzmittel auch ausgeschöpft werden können und nicht wie bisher oft nur zu 40 Prozent
- ausreichend städtisches Personal für Planung und Controlling einstellen (wie es Frankfurt sogar mit einem eigenen Amt für Bau und Immobilien – ABI gemacht hat)
- Grundstücke bereitstellen, das heißt, der Grundstücksspekulation einen Riegel vorzuschieben
- für eine nachhaltige generationengerechte Finanzausstattung sorgen
Den gemeinsamen Kampf gegen die „Schuldenbremse“ führen, damit nicht die öffentliche Infrastruktur verfällt und auf Privatisierungen ausgewichen werden muss!
Die Autor/inn/en des Standpunktpapiers benennen leider nicht, welche Parteien die skizzierte Politik des Abbaus der staatlichen Nettoinvestitionen vorangetrieben haben. Denn dann müsste ja gefragt werden, ob dort ein Umbesinnungsprozess eingeleitet wurde. (S. 1 oben) Die jüngst vom Berliner Senat vorgenommene Sondertilgung stimmt da nicht gerade optimistisch. [9]
Die Autor/inn/en schreiben:
„Diese gesamtwirtschaftliche Investitionsschwäche wurde in den letzten Jahren umfänglich analysiert und diskutiert. Trotzdem hat ein Kurswechsel der Bundespolitik bisher nicht stattgefunden. Die Dogmen schwarzer und roter Nullen feiern weiter fröhliche Urstände.“ (S.2 oben)
Das mag für kritische Fachleute gelten, aber diese Teilöffentlichkeit ist viel zu klein. Erst eine Kampagne, die Gewerkschaften und kritische Masseninitiativen einbezieht, zur Revision der „Schuldenbremse“, mindestens zur Wiederanwendung der „goldenen Regel“ könnte eine entsprechend breite öffentliche Diskussion in Gang setzen und eventuell etwas bewirken.
Mit scheinbaren Tricks wie ÖÖP lässt sich das Problem weder lösen noch auch nur umschiffen.
Dass es schon so schwierig ist, bei SPD und Grünen die dringend notwendigen „substanziellen Erhöhungen der Einnahmen des Gesamtstaats“ (S. 2) programmatisch zu verankern, zeigt, wie weit die ideologische Verblendung reicht.
Der Kritik an dem Kreditaufnahmeverbot durch die „Schuldenbremse“ auf den Seiten 3 und 4 kann weitgehend gefolgt werden. Sie sollte Teil der überfälligen Kampagne zur Rettung der Handlungsfähigkeit des Staates und der Kommunen sein.
Dazu gehört auch die kritische Aufarbeitung des Prozess der Verankerung von ÖPP im Grundgesetz 2017, dessen Auswirkungen noch gar nicht abgeschätzt werden können und dem alle Landesregierungen nach der erpresserischen Verknüpfung mit dem Länderfinanzausgleich wenn auch unter Protest zugestimmt haben.
Es sind aber nicht nur solche Finanzkonstruktionen, sondern die Ideologie und Politik „Privat vor Staat“, wie sie die CDU in Hessen unter Roland Koch zum offiziellen Regierungsprogramm erhoben hatte, der die „Schuldenbremse“ wie eine „Rutschbahn“ zuarbeitet.
Schließlich müsste von marxistischen KritikerInnen auch das ungebändigte anlagesuchende Kapital genannt werden, das den öffentlichen Bereich in ein Kapitalverhältnis zu verwandeln sucht.
Es ist also nicht nur „aus ökonomischer Sicht willkürlich“ (S. 3 oben), dass und wie das Verschuldungsverbot gesetzlich verankert wurde, sondern es ist für das Privatkapital durchaus logisch und nützlich – für diejenigen ohne Kapital allerdings nicht. Ganz im Gegenteil!
Erst wenn dies permanent ins Bewusstsein gehoben wird, lässt sich vielleicht gesellschaftlich etwas bewegen.
Und schließlich müsste die Unterscheidung von Sach- und Personalinvestitionen als „investive“ und „konsumtive“ Ausgaben endlich überwunden werden. Denn mittlerweile konnte die öffentliche Kritik an den zwar bereitgestellten, aber nicht abgerufenen, weil mangels Personal nicht verplanbaren Haushaltsmitteln auf allen Ebenen ins Bewusstsein gehoben werden.
Berlin/Frankfurt am Main, 5. August 2018
______________________________________________________________________
[1] https://www.axel-troost.de/de/article/9843.zukunftsinvestitionen-ermöglichen.html
Papier vom 25.7.2018 (Dullien, Hirschel, Priewe, Reiner, Trochowski, Troost, Truger, Wolf)
[2] Die Mitglieder des Beteiligungsausschusses dürfen die Verträge in einem „Datenraum“ ansehen, aber weder ihre Notizen mitnehmen noch auch nur außerhalb nichtöffentlicher Sitzungen über das Gesehene sprechen.
[3] Die Gemeindesteuereinnahmen betrugen pro Einwohner 2014 nur die Hälfte derjenigen Hamburgs und nur ein Drittel der Einnahmen in Frankfurt am Main
[4] GiB: Kurzstudie zur Entwicklung der Ausgaben für Schulbau und -sanierung in Berlin 2012 bis 2017
[5] Berliner Morgenpost, 23.11.17
[6] SenBJF: Berlin baut neue Schulen, Mai 2018
[7] RdB-Vorlage Nr. R 172/2017 vom 11.08.17
[8] Am 2.8.18 urteilte das Amtsgericht Bottrop, dass der DKP-Stadtrat Michael Gerber durch seine öffentliche Information über die Höhe der Erfolgsbeteiligung bei der städtischen Entsorgungsfirma Geschäftsgeheimnisse verraten habe: https://www.jungewelt.de/artikel/337277.freispruch-mit-makel.html
[9] „Nach einer Studie der Bertelsmann-Stiftung würden zielgerichtete öffentliche Investitionen in qualitativ hochwertige Kitas und Ganztagschulen, in bezahlbaren Wohnraum für Bevölkerungsgruppen mit mittleren und niedrigen Einkommen sowie in eine moderne digitale Infrastruktur insbesondere im Vergleich mit einer sofortigen Schuldentilgung nicht nur das Wachstum und die Beschäftigung steigern, sondern auch die Einkommensungleichheit in Deutschland verringern.“ (S. 1 unten, Hervorhebung d.Verf.)