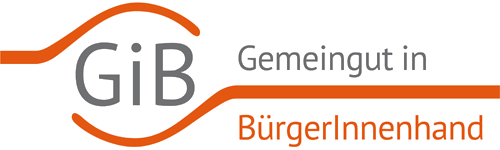Gemeingut-Infobrief zum SEZ: Das SEZ steht noch – weil wir dafür kämpfen!
Im Infobrief berichtet Gemeingut in BürgerInnenhand über die Ergebnisse des dritten Runden Tisches, über aktuelle Termine, vor allem über die anstehende Anhörung im Sportausschuss, an der Interessierte teilnehmen können, sowie über weitere Handlungsmöglichkeiten, mit denen alle zur Rettung des SEZ beitragen können.