
Von Laura Valentukeviciute, GiB
Das aktuelle Vorhaben des Berliner Senats, Schulgrundstücke und Immobilien zu privatisieren, entstand nicht zufällig. Es ist ein Ergebnis langjähriger Überlegungen, wie private Akteure, insbesondere Banken, Pensionsfonds, aber auch kleinere Anleger, Beratungsunternehmen und die Bauindustrie von den verschiedenen Bereichen der Daseinsvorsorge direkt profitieren können. Die letzten einschlägigen Leitfäden dazu produzierten unter anderem die sogenannte Fratzscher-Kommission und das Beratungsunternehmen PricewaterhouseCoopers (PwC). Die Berichte der Fratzscher-Kommission, die 2014 von dem damaligen Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel einberufen wurde, wurden schon mehrfach analysiert. Das Gutachten von PwC fand bisher wenig Beachtung. Die Analyse des 2016 erschienenen Gutachtens lohnt sich, denn es ermöglicht einen Einblick in das Wunschdenken der Privatisierungsakteure.
Das Gutachten wurde ebenso wie die Fratzscher-Kommission vom Ministerium für Wirtschaft und Energie in Auftrag gegeben. Es sollte „Rechtliche und institutionelle Voraussetzungen zur Einführung neuer Formen zur privaten Finanzierung öffentlicher Infrastrukturvorhaben unter Einbindung einer staatlichen Infrastrukturgesellschaft“ ausloten. Die Fratzscher-Kommission hatte nämlich vorgeschlagen, neue Fondsmodelle zur Mobilisierung zusätzlicher privater Infrastrukturfinanzierung zu prüfen. Und diese Prüfung führte PwC durch.
Zentralisierung
Das PwC-Gutachten weist den Weg hin zu mehr privater Kreditaufnahme bei gleichzeitig mehr und neuen privaten Akteuren. Und es sieht eine enorme Ausweitung öffentlich-privater Partnerschaften (ÖPP) vor. Wobei die ÖPP-Strukturen so verschachtelt werden sollen, dass man sie nur bei tiefergehender Analyse erkennen kann. Das verwundert nicht, denn nach den bisherigen Erfahrungen mit ÖPP gibt es in der Gesellschaft große Vorbehalte gegen ÖPP. Die Durchsetzung dieser Privatisierungsform stößt schon seit einigen Jahren auf Widerstand. Und genau dem muss entgegengewirkt werden. Es soll nicht mehr möglich sein, bei Einzelprojekten, ob Schule, Verwaltungsgebäude oder Autobahnabschnitt, eine Entscheidung für oder gegen ÖPP zu treffen. Die Projekte sollen gebündelt und zentralisiert werden, das heißt den lokalen Entscheidungsträgern aus der Hand genommen werden, und dann als ÖPP umgesetzt werden.
Dieses Vorgehen hatte bereits die Fratzscher-Kommission für die Autobahnen vorgeschlagen. Mit der Grundgesetzänderung Anfang Juni 2017 wurde die Zentralisierung und die Überführung der Autobahnen in eine bundeseigene Infrastrukturgesellschaft beschlossen. Die Länder, die zuvor für Bau und Betrieb der Autobahnen im Auftrag des Bundes zuständig waren, können die geplanten ÖPP-Autobahnprojekte seither nicht mehr aufhalten oder ablehnen.
Die Zentralisierung begründet PwC mit Kostensenkung. Denn: „Eine […] Projektfinanzierung erfordert regelmäßig einen aufwändigen Strukturierungsprozess und damit hohe Transaktionskosten […]. Dieses Problem kann durch die Errichtung einer zentralen Institution gelöst werden, die den Strukturierungsprozess weitgehend standardisiert, die Projekte bündelt und als Mittler zwischen Kommune und Investoren agiert.“ (S. 7)
Besonders erwünscht ist dabei die Standardisierung der Projekte, um das Risiko zu mindern und so mehr Investoren anzulocken: „Um auch kleinere Projekte für Infrastrukturfonds bzw. für die typischen Anleger solcher Fonds attraktiv zu machen, wird eine Bündelung vieler standardisierter gleichartiger Projekte erforderlich sein“ (S. 31).
Die Anleger in einem solchen Infrastrukturfonds könnten laut PwC zum Beispiel Pensionskassen oder Versorgungswerke sein. Es fehlt lediglich der Rechtsrahmen dafür. Unerwähnt lässt PwC die Tatsache, dass die Vermengung von Pensionskassen und ÖPP-Projekten Erpressungspotenzial gegenüber den Steuerzahlenden birgt: Gerät ein ÖPP-Projekt in Schieflage, müssen die SteuerzahlerInnen dafür aufkommen und werden einerseits gezwungen, die Einlagen der Pensionskassen (soll man die RentnerInnen fallen lassen?) und andererseits die ÖPP-Projekte (eine Autobahn kann nicht für längere Zeit einfach gesperrt bleiben) zu retten. Die beteiligten Kreditgeber profitieren aber unverändert weiter, denn unter diesem Druck wird die öffentliche Hand aus dem ÖPP-Vertrag nicht aussteigen.
Management
Desweiteren macht PwC Vorschläge für die Verwaltung der Projekte: Investoren sollen nicht nur Finanzkapital bereitstellen, sondern auch das Management. Begründet wird das mit der Entlastung der Kommunen sowohl finanziell als auch personell. PwC schreibt: „Indem institutionelle Investoren Management-Kompetenzen bereitstellen, um typische kommunale Infrastrukturvorhaben wie etwa die Errichtung von Schulen und Kindergärten oder die Sanierung kommunaler Straßenbrücken, Flüchtlingsunterkünfte, einfache Wohnungen1 für eine Vielzahl von Kommunen zu übernehmen, können Wirtschaftlichkeitspotenziale realisiert und die Kommunen sowohl finanziell als auch administrativ entlastet werden.“
Und PwC ergänzt: Das Management soll nicht jeder übernehmen. „Die Bereitstellung von Management-Kompetenzen und die Übernahme von Steuerungsfunktionen sind nur für entsprechend spezialisierte institutionalisierte Anleger möglich und sinnvoll.“ (S. 3). Das Management soll zwar per Ausschreibung ausgesucht werden, aber für die Daseinsvorsorge ist das ein schwacher Trost: Denn welche Interessen wird ein Manager oder eine Managerin zum Beispiel von der Deutschen Bank oder der Allianz Versicherung wohl bedienen?
Strukturwirrwarr und Interessenkollision
PwC schlägt eine verschachtelte Struktur mit den Projektgesellschaften ersten Grades (Geld und Management) und zweiten Grades (tatsächliche Durchführung der Projekte beziehungsweise Beauftragung ausführender Unternehmen) vor. Die beteiligten Akteure aus dem öffentlichen und privaten Sektor sollen in beiden Projektgesellschaften gemeinsam agieren. In der Projektgesellschaft ersten Grades soll das wie folgt aussehen: „Um eine angemessene Berücksichtigung der Interessen der Vorhabenträger [Aut.: d.h. z.B. Kommunen] zu gewährleisten, bietet es sich an, eine Beteiligung der öffentlichen Hand vorzusehen. Diese Beteiligung sollte durch eine Institution erfolgen, die zugleich das Vertrauen der Anleger genießt, so dass sie die Funktion einer Kontrollinstanz und eines Interessenkorrektivs auf der Anlegerseite tatsächlich wahrnehmen kann. Möglich wäre etwa eine Beteiligung der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)“. Es ist also nicht klar, welche Interessen die KfW vertreten soll: die der öffentlichen Hand oder der Anleger.
Die Gesellschaft zweiten Grades dient der tatsächlichen Durchführung der Projekte („jeweils eines konkreten Vorhabens eines einzelnen Vorhabenträgers“). „Sie [Aut.: die Gesellschaft zweiten Grades] wird durch die übergeordnete Projektgesellschaft [Aut.: das ist die Gesellschaft des ersten Grades] mit (Eigen)Kapital ausgestattet und durch diese Gesellschaft gesteuert.“ Hier setzt sich die Kollision der Interessen fort. Hinzu kommt, dass auch an dieser Gesellschaft sowohl die öffentliche Hand als auch das ausführende Unternehmen [Aut.: z.B. Generalübernehmer] beteiligt werden können: „Optional kann der Vorhabenträger oder das ausführende Unternehmen an der untergeordneten Projektgesellschaft als Minderheitsgesellschafter beteiligt werden.“ (S. 5)
Neuer Name, alte Gepflogenheiten
Der dritte Akteur im Wirrwarr ist die staatliche Infrastrukturgesellschaft, die mit der Projektgesellschaft ersten Grades eng zusammenarbeitet und „standardisierte Finanzierungsstrukturen, Ausschreibungsunterlagen und Vertragswerke unter Berücksichtigung eines fairen Interessensausgleichs bereitstellt und das Vertrauen aller Beteiligten genießt“. (S. 3) Außerdem soll sie Rahmenbedingungen für die Einbeziehung des vierten Akteurs – des öffentlich-privaten Infrastrukturfonds – schaffen.
An der Infrastrukturgesellschaft sollen aus vergaberechtlichen Gründen (In-House-Fähigkeit) Bund, Länder und Kommunen beteiligt sein – d.h. die öffentliche Hand soll Miteigentümer in der Gesellschaft sein, um die öffentlichen Ausschreibungen für die Beratungsleistungen zu umgehen. Beratungsleistungen haben eine wichtige Funktion bei der Wahl zwischen einem ÖPP-Projekt und einer Projektdurchführung in öffentlicher Hand. Die Gefahr, dass via Ausschreibung BeraterInnen hinzugezogen werden, die kein ÖPP empfehlen, muss eliminiert werden. Das passiert unauffällig durch die In-House-Vergabe. Ein wichtiger Akteur bei der Beratung war bis vor einigen Jahren die ÖPP Deutschland AG, mit Bernward Kulle, einem ehemaligen Manager von Hochtief an der Spitze. Sie firmierte dann auch unter dem Namen Partnerschaften Deutschland AG und heißt seit 1. Januar 2017 PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH.
Die jetzt von der PwC vorgeschlagene Infrastrukturgesellschaft weist große Ähnlichkeiten mit der genannten Berateragentur auf, und genau das war einer der Aufträge der Fratzscher-Kommission: die ÖPP Deutschland AG zu reformieren bzw. eine Infrastrukturgesellschaft für die Kommunen zu schaffen.
Einfallstor Eigenkapital
Die Fratzscher-Kommission forderte in ihrem Bericht, dass die beteiligten Gesellschaften mehr Eigenkapital in die Projekte einbringen, um so eine „echte Risikoübertragung“ zu erwirken. Das klingt erst mal vernünftig, denn mit wenig Eigenkapital steht die Finanzierung von millionen- und milliardenschweren Projekten auf wackeligen Beinen. So zum Beispiel bei der Projektgesellschaft A1 Mobil. Die Gesellschafter Bilfinger, John Laing und Johann Bunte investierten nur 36.000 Euro Eigenkapital in eine Gesellschaft, die ein Autobahnprojekt bauen und betreiben soll, das gut eine Milliarde kostet. Als die geplanten Einnahmen nicht erzielt wurden, drohte der Projektgesellschaft Insolvenz und sie zog vor Gericht, um mehr Geld von dem Bund zu bekommen.
Vor diesem Hintergrund klingt der Vorschlag nach mehr Eigenkapital vernünftig. Erst beim genaueren Hinschauen erweist er sich als eine weitere Möglichkeit, mehr Geld zu bekommen und zwar über höhere Zinsen. Denn das Eigenkapital ist teuer, d.h., es werden höhere Zinsen verlangt, und genau das ist für die Anleger interessant. Das begründet auch PwC (S. 19) wie folgt: „Ein solcher Infrasturktur-Fonds investiert typischerweise in Eigenkapital, und auch ein Kreditfonds hat in der Regel keinen ausreichenden Anreiz, in Forderungen zu investieren, die zu kommunalkreditähnlichen Konditionen verzinst werden.“
Die kommunalähnlichen Konditionen bedeuten, dass für die aufgenommenen Kredite nur sehr niedrige Zinsen verlangt werden können. Der Grund ist: Die öffentliche Hand ist ein sicherer Schuldner und insbesondere Deutschland (der Bund, die Länder und die Kommunen) zahlt seine Kredite verlässlich zurück. Es gibt also kein Kreditausfallrisiko und somit keinen Grund, höhere Zinsen zu verlangen. Damit die Finanzindustrie für die gleichen sicheren Kredite, die die öffentliche Hand regelmäßig und zuverlässig bedient, doch mehr Rendite erhält, wurde eben ein Euphemismus kreiert: mehr Eigenkapital. Die Folge ist: Die Unternehmen erhöhen den Anteil des Eigenkapitals und bekommen für diesen Anteil höhere Zinsen. An der Bonität der öffentlichen Hand ändert es aber nichts. Sie wird nach wie vor die Kredite und Zinsen sicher zurückzahlen, die durch den Trick allerdings teurer werden, denn bei ÖPP-Projekten sind Eigenkapitalrenditen von 30 Prozent pro Jahr üblich. (S. 5, Lunapark21 Extra Nr. 16/17)
Trotzdem bedeutet „mehr Eigenkapital“ in der Sprache der Finanzindustrie auch „mehr Risiko“ und das klingt im PwC-Gutachten wie folgt: „Alternative Finanzierungsformen in diesem Bereich unter der Einbringung von Eigenkapital sind grundsätzlich geeignet, der Forderung der Fratzscher-Kommission nach einer echten Risikoübertragung auf den privaten Partner nachzukommen.“ (S. 20) PwC beschreibt, also was Herr Fratzscher noch verschwieg: Wenn der Private angeblich mehr Risiken übernimmt, muss die öffentliche Hand dafür auch ordentlich draufzahlen.
Dass die Risikoübertragung nicht stattfindet, wird aus dem Zusammenhang deutlich, der am Anfang schon angerissen wurde: Die Privaten sollen ja auch die Steuerung und die Kontrolle für die Projekte übernehmen. „Dieser neue Weg der kommunalen Infrastrukturbereitstellung basiert auf einer Bereitstellung von Eigenkapital gepaart mit Steuerungs- und Kontrollmöglichkeiten der privaten Investoren und ermöglicht daher eine echte Risikoübertragung.“ (S. 2) Wenn ein privates Unternehmen die Steuerung und die Kontrolle übernimmt, dann wird es ganz sicher dafür sorgen, alle Risiken eben nicht selbst zu tragen, sondern der öffentlichen Hand zu überlassen.
Schulen in Berlin
Der rot-rot-grüne Senat in Berlin plant gerade ein umfangreiches Schulsanierungs- und Bauprogramm, die so genannte Schulbauoffensive. Auch die Berliner Linke macht mit und verteidigt das Vorhaben u.a. im Beitrag „Zukunftsinvestitionen ermöglichen – Spielräume der Schuldenbremse in den Bundesländern nutzen!“ (s. von Dullien, Hirschel, Priewe, Reiner, Trochowski, Troost, Truger und Wolf). Die Schulbauoffensive weist allerdings erschreckende Ähnlichkeiten mit dem Gutachten von PwC auf: Allem voran sollen mehrere Schulen gebündelt, zentralisiert und typisiert werden. Die Linke nutzt in ihrem Papier sogar das gleiche Vokabular und die gleiche Begründung für die Vorteilhaftigkeit des gewählten Modells. So heißt der Vorschlag von PwC: „Die Gesellschaft kann Investoren vermitteln, die auf Basis standardisierter Lösungen für eine Vielzahl gleichartiger Projekte als Finanzierungs- und Managementpartner zur Verfügung stehen. Durch die Bündelung einer Vielzahl von Projekten können Skaleneffekte generiert werden.“ (S. 7) Im Papier der Linken steht: „Zudem überzeugt das Argument des Berliner Senats, dass eine Zentralisierung des Schulbaus und auch die Einbindung von Generalunternehmern nötig sind, um durch modulare Systembauweise und Typisierung Skaleneffekte und eine Beschleunigung der Bauverfahren zu ermöglichen“. (S. 7)
Fazit
Die Analyse des Fratzscher-Berichts und des 2016 folgenden PwC-Gutachtens zeigt, dass das neue Modell nicht von der Privatisierung abrückt, sondern sie nur effektiver tarnt. Der Erhalt der öffentlichen Infrastruktur wird nach wie vor aus den Steuergeldern oder Gebühren finanziert. Aber es werden immer neue Wege ersonnen, wie bei dem großen Investitionsvolumen die Privaten einen möglichst großen Teil vom Kuchen abbekommen. Und Die Linke in Berlin macht mit.
1Am 27.09.2018 forderte der Finanzminister Olaf Scholz eine Grundgesetzänderung, laut der der Bund direkt an die Kommunen Mittel sowohl für Schulen als auch für Wohnungen bereitstellen soll.
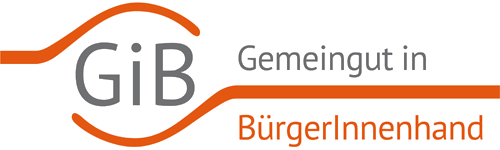
Pingback:Gemeingut » Blog Archive » GiB-Infobrief: Direkte Demokratie hilft gegen Privatisierungen