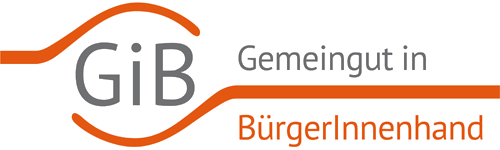07.01.2013, von Laura Valentukeviciute.
In den Zeiten der Krise werden die Rufe nach einem dritten Weg immer lauter. Und dabei geht es nicht um den so genannten goldenen dritten Weg, den die privaten Konzerne und ein immer noch großer Teil der PolitikerInnen mit Public Private Partnerships (PPP) anstreben. In der gesellschaftlichen emanzipatorischen Debatte ist mit dem dritten Weg die Gemeingüterwirtschaft gemeint. Also die Art und Weise des Wirtschaftens, bei der im Mittelpunkt nicht Wettbewerb, Effizienz und Gewinnmaximierung stehen, sondern das Recht der Menschen auf alle Güter, ohne die ihre Existenz gefährdet und nicht in Würde möglich wäre. Dies umfasst nicht nur klassischerweise Wasser, Abwasser, Bildung oder Mobilität, sondern auch Rente, Luft, Biodiversität und vieles mehr. Gemeingüter minimieren Lebensrisiken, indem sie die Kosten dafür auf mehrere Schultern in der ganzen Gesellschaft verteilen. Das setzt aber die Bereitschaft voraus, nicht nur eigene Risiken, sondern auch die Risiken der Mitmenschen zu übernehmen. Das alte Wort dafür ist Solidarität.
Gemeingüter ist ein ziemlich neuer Begriff im deutschsprachigen Raum, mit dem wir gerade erst warm werden. Der Begriff „Öffentliche Güter“ ist verbreiteter und wird häufiger als Äquivalent für Gemeingüter benutzt, wobei es besonders in Deutschland eine große Debatte darüber gibt, wo genau der Unterschied zwischen den beiden Begriffen liegt. Im Gegensatz zur deutschen Debatte ist die Unterscheidung in anderen Ländern wie Griechenland, England, Italien u.a. so gut wie nicht existent. Die Antiprivatisierungsgruppen dort bezeichnen auch die für uns klassischen öffentlichen Güter (public goods) wie die Wasserversorgung als Gemeingüter (commons).
Diese Gruppen und manche Gemeingütertheoretiker machen keinen substanziellen Unterschied zwischen Gemeingütern und öffentlichen Gütern, aber einen Unterschied darin, wie diese Güter verwaltet werden. Denn im Falle der öffentlichen Güter gilt das Delegationsprinzip: die öffentliche Hand übernimmt die Verwaltung und Kontrolle. Indes werden die Gemeingüter partizipativ von allen NutzerInnen verwaltet.
Aus den Fehlern der Privatisierungspolitik zu lernen heißt auch, die Dinge in die eigene Hand zu nehmen – die öffentlichen Güter zu Gemeingütern zu machen. Diese Tendenz wird an aktuellen Beispielen sichtbar: Die Bewegung 136 in Griechenland schlägt für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung ein soziales Management durch Genossenschaften auf nachbarschaftlicher Ebene vor und der Berliner Energietisch fordert, dass im Gesetz, das Anfang Februar in die zweite Runde eines Volksentscheides geht, BürgerInnenbeteiligung und demokratische Kontrolle durch NutzerInnen möglich ist.
Die Partizipation in der Gemeingüterwirtschaft heißt aber nicht, dass es keinen Platz für die öffentliche Hand mehr gibt. Sehr treffend formulierte Alberto Luccarelli, der Commons-Theoretiker aus Italien, die Rolle der öffentlichen Hand wie folgt: Wir brauchen „öffentliche Institutionen als formale Eigentümer, die von Bedürfnissen der Menschen ausgehen, der Absicherung der Grundrechte verpflichtet sind und vom wirtschaftlichem Wachstum unabhängig agieren können“. Und ergänzt, dass wir „eine Begrenzung der Rechte des Staates, was die Verfügung über öffentliches Eigentum betrifft“, benötigen.
Solche Ansätze erfordern starke Umbrüche in der Politik. Es muss als Erstes die Vorstellung sich verfestigen, dass die BürgerInnen das Recht darauf haben zu wissen, was mit ihren Gemeingütern passiert. Auch müssen die gesetzlichen Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden, dass die BürgerInnen an der Entscheidungsfindung partizipieren. Das Debakel um die Offenlegung der Privatisierungsverträge der Berliner Wasserbetriebe hat gezeigt, dass genau an diesem Punkt noch sehr viel zu tun ist: der erfolgreiche Volksentscheid, initiiert vom Berliner Wassertisch wurde von den PolitikerInnen praktisch ignoriert.
Eine zarte Blüte auf dem Feld der BürgerInnenbeteiligung ist die seit dem 1. April 2012 mögliche Europäische Bürgerinitiative. Damit können EU-BürgerInnen die Europäische Kommission auffordern, sich mit bestimmten Fragen zu befassen. Die ersten Initiativen sind schon gestartet, es geht dabei z.B. um die Verhinderung von Wasserprivatisierung („Wasser ist ein Menschenrecht“) um die Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens („Netzwerk Grundeinkommen“) oder wie beim „Tempo 30“ um einen menschenfreundlichen Verkehr.
Allzu große Hoffnungen dürfen dabei leider nicht gehegt werden, weil sich die Europäische Kommission dann nur mit diesen Fragen beschäftigen muss. Trotzdem ist es ein Instrument, mit dem man anfangen kann, sich um die Sachen zu kümmern, die uns alle angehen. Allerdings ist mit einer Unterschrift nur der erste Schritt getan. Mitsprache und demokratische Kontrolle können nur wir selber mit Leben füllen und sie kommen erst dann, wenn wir uns aktiv dafür einsetzen.
Der Artikel ist zuerst erschienen am 27.12.2012 unter www.neues-deutschland.de/rubrik/in-bewegung