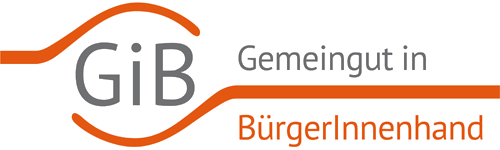Der Endspurt für den Appell „PPP ade!“
Schulen, Krankenhäuser, Straßen, Wasserversorgung und andere öffentliche Güter gehören uns und sind keine Goldgrube für die privaten Investoren. Das soll nun endlich auch Finanzminister Schäuble verstehen! Deswegen unterschreibt noch bis zum 23.6. den Appell „PPP ade“ und fordert den Finanzminister persönlich auf, PPP in der Bundesrepublik abzuschaffen. Bis jetzt haben …