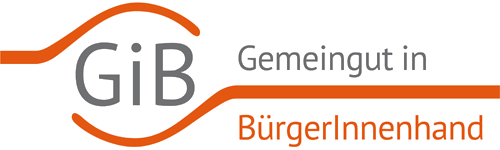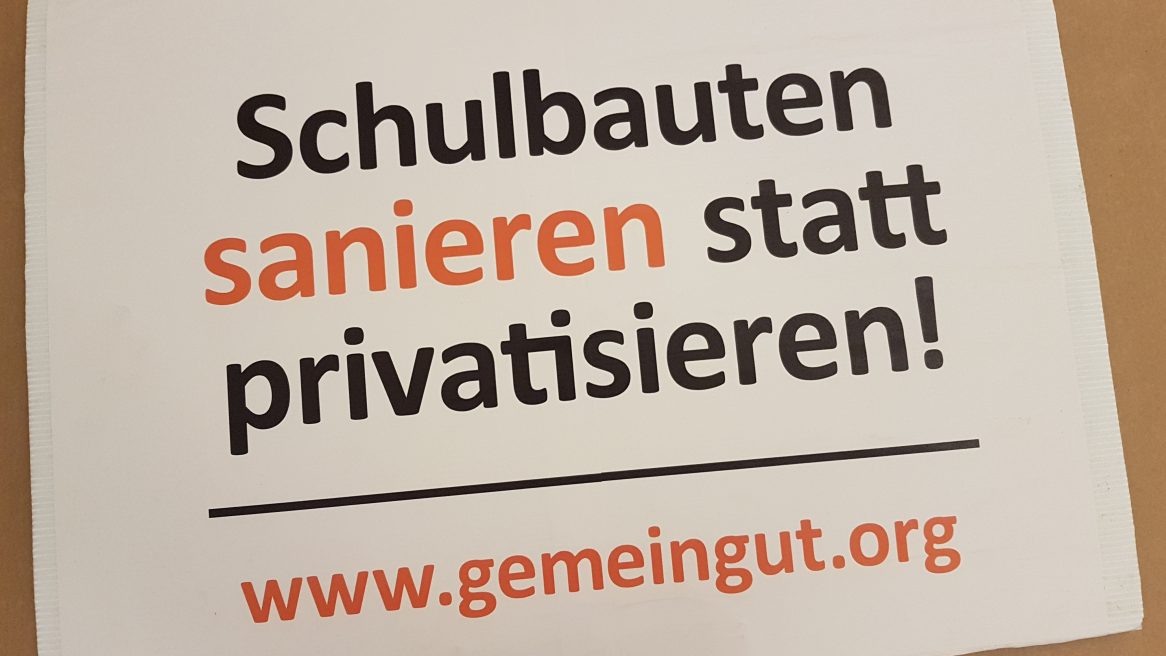Runder Tisch zum SEZ gegründet
Pressemitteilung von Gemeingut zur Gründung des Runden Tisches zum SEZ. Mit dem Runden Tisch SEZ wurde ein Ort geschaffen, an dem über die Zukunft des Berliner Sport- und Erholungszentrums (SEZ) gesprochen wird. Die Berliner Landesregierung und die Wohnungsbaugesellschaft Mitte WBM sind herzlich eingeladen, sich einzubringen.