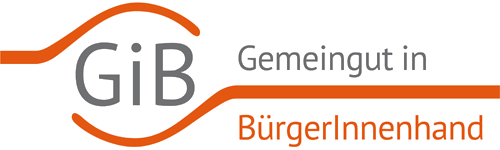Von Dr. Rainer Neef, Jorinde Schulz und Carl Waßmuth
Die niedersächsische Landesregierung plant in einem neuen Gesetzesentwurf, die Krankenhauslandschaft im Bundesland radikal auszudünnen. Demnach sollen 30 bis 40 der derzeit 168 Krankenhäuser Niedersachsens schließen. Der Kahlschlag forciert den schon seit Jahren stattfindenden Schließungsprozess. So weist die Krankenhausstatistik für Niedersachsen für 2010 noch 198 Krankenhäuser aus, 2019 waren es 177 – ein Rückgang um zwölf Prozent. Niedersachsen plant damit einen signifikant höheren Abbau seiner Klinikstandorte als der Bundesdurchschnitt: Auf Bundesebene wurde die Zahl der Krankenhäuser im Zeitraum 2010 bis 2019 von 2.064 auf 1.914 verringert, das heißt um gut sieben Prozent. Schon das ist zu viel. Das Grünbuch 2020, herausgegeben vom Bundesinnen- und Bundesforschungsministerium, attestierte den deutschen Krankenhäusern bereits im Dezember 2020 unzureichende Vorsorgekapazitäten für Pandemien.
In die Debatte um die angekündigten Krankenhausschließungen platzte ein Bericht der ostfriesischen Nordwest-Zeitung (NWZ) über den Besuch der Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) in Emden1. Sie befürwortete warm das auf der grünen Wiese bei Georgsheil neu zu bauende Zentralklinikum im westlichen Ostfriesland. Nach seinem Bau sollen die drei mittelgroßen Kliniken Aurich, Emden und Norden geschlossen werden, voraussichtlich im Jahr 2027. Vor Ort haben die Schließungspläne zu massiven BürgerInnenprotesten geführt. Wie in vielen anderen Fällen beginnt der Schließungsprozess auch hier lange vor der Fertigstellung der versprochenen Zentralklinik: So schloss der Kreißsaal in Emden schon Ende März 2021. Dies schien den Enthusiasmus der Gesundheitsministerin keinesfalls zu schmälern. In ihrer Begeisterung über das „Megaprojekt“ übersah sie Probleme mit der Erreichbarkeit, zu welchen die geplanten Schließungen führen werden. Kein Wunder, denn in der Präsentation des Projekts hatten die Kreisbehörden den Zirkel der Erreichbarkeit vorsichtshalber auf 40 Pkw-Fahrminuten ausgedehnt. Das widerspricht der offiziell definierten Erreichbarkeitsgrenze von 30 Fahrminuten.
Wohnortnähe? Fehlanzeige!
Selbst bei einem 40-Minuten-Fahrradius gibt es rund 15.000 EinwohnerInnen aus der Stadt Wiesmoor und Umgebung sowie aus dem nordöstlichen Küstenstrich bei Dornum, die das Zentralklinikum nicht in 40 Minuten erreichen. Bei 30 Fahrminuten lassen sich aus dem Schließungssimulator der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV-Simulator) für das ganze Gebiet mindestens 25.000 EinwohnerInnen schätzen, die im Rettungsfahrzeug in dieser Zeit das neue Zentralkrankenhaus nicht erreichen werden. Auch die Krankenhäuser Wittmund und Westerstede in angrenzenden Landkreisen, auf die die Unterlagen verweisen, können zwar in 40, nicht aber in 30 Fahrminuten erreicht werden. Die geplante Zentralklinik stellt damit absehbar eine deutliche und vorschriftswidrige Verschlechterung dar.
Ähnlich ist die Lage im östlichen Ostfriesland. Dort ist eine Zentralklinik in Twistringen geplant, die voraussichtlich 2027 oder 2028 arbeitsfähig sein wird. Dafür sollen die Krankenhäuser in Bassum, Diepholz und Sulingen geschlossen werden. Dabei stehen dem Krankenhaus in Sulingen als unentbehrlichem ländlichem Krankenhaus Zuschüsse der GKV zu, der sogenannte Sicherstellungszuschlag. Circa 28.000 Einwohner werden die Zentralklinik in Twistringen nicht binnen 30 Pkw-Minuten erreichen können.
Unsummen für Neubau – gegen den Willen der BürgerInnen
Die geschätzten Baukosten für das Zentralklinikum in Georgsheil lagen zuletzt bei mindestens 600 Millionen Euro. In ersten, wesentlich optimistischeren Schätzungen waren es noch 250 Millionen. Die Gesundheitsministerin hat versprochen, dass sich das Land mit 70 Prozent an den Kosten beteiligen wird. Nur durch diese Förderung ist das Projekt überhaupt machbar. Von der in Aussicht gestellten Landesförderung ließen sich schätzungsweise die sechs ostfriesischen Krankenhäuser, die aufgrund der Neubauten in Georgsheil und Twistringen schließen sollen, grundlegend modernisieren und die Gehälter der Pflegenden angemessen aufstocken. Das ließ die Ministerin allerdings in ihrem Lob des „Megaprojekts“ unerwähnt.
Die Bezeichnung „Megaprojekt“ ist aufschlussreich. Sie erinnert an andere Megaprojekte, deren zerstörerischer Charakter bereits aufgedeckt wurde, wie Staudämme, Stuttgart 21 et cetera. Auch dort handelt es sich um aufgezwungene Projekte, die gegen den expliziten Willen der Bürgerinnen und Bürger umgesetzt werden. Im NWZ-Artikel heißt es scheinheilig: „Das Projekt war lange umstritten. In zwei Bürgerentscheiden konnten Bürger darüber abstimmen.“ Dazu fehlen wichtige Informationen. Der erste Bürgerentscheid fand 2017 statt und wurde von BürgerInnen initiiert. Damals stimmten 62 Prozent für den Erhalt des Emder Klinikums, in der benachbarten Stadt Aurich waren es 63 Prozent, die für den Erhalt der dortigen Ubbo-Emmius-Klinik votierten. Zwei Jahre später rief die Stadt erneut einen Bürgerentscheid ins Leben, in den die Trägergesellschaft der Kliniken 200.000 Euro investierte. Doch immer noch stimmten 46 Prozent für den Erhalt des Emder Krankenhauses. Das blieb nicht ohne Konsequenzen, so dass im vergangenen November der niedersächsische Landtag weitere Bürgerentscheide über Krankenhausstandorte gesetzlich unterband: „Unzulässig ist ein Bürgerbegehren über […] Entscheidungen als Träger von Krankenhäusern.“2 SPD und CDU begründeten die Gesetzesänderung unter anderem damit, dass die bedarfsgerechte medizinische Versorgung der Bevölkerung zu wichtig sei, um sie einer hochemotional aufgeladenen Entscheidung zu überlassen. Ihnen ist offensichtlich das Risiko zu groß, dass engagierte BürgerInnen vor Ort Klinikschließungen verhindern – dafür musste das demokratische Instrument dran glauben.
Desaströse Megaprojekte
Die Zerstörung, die von Megaprojekten ausgeht, ist umfassend: Sie erfolgt ökologisch, sozial und gleichzeitig ganz materiell. Zerstört werden zunächst die intakten Arbeitsstrukturen der Teams, die nahräumliche stationäre Versorgung, die Arbeitsplätze am Ort. Funktionierende Arbeitsabläufe, die MitarbeiterInnen über Jahre aufgebaut haben, sowie gewachsene Strukturen in der Gemeinde fallen der Schließung zum Opfer.
Auch die Gebäude der bestehenden Kliniken werden zerstört, denn Krankenhäuser lassen sich kaum umnutzen, wenn überhaupt, dann nur mit massivem Teilabriss. Die örtliche Medizintechnik muss ebenso dran glauben, denn die meisten Geräte sind ortsfest oder werden im Rahmen der Zentralisierung für veraltet erklärt. Ohne Not werden diese Werte vernichtet.
Der Neubau ist ebenfalls zerstörerisch. Im Fall Georgsheil stellt er keine Erweiterung der Kapazität an Betten und Versorgung dar, sondern eine Reduktion. Dafür wird die grüne ostfriesische Wiese dauerhaft versiegelt, werden tausende Tonnen überwiegend schädlicher Baumaterialien untrennbar miteinander verbunden und in die Umwelt eingebracht, darunter viele toxische Kunststoffe sowie in der Gewinnung extrem umweltschädliche Materialien wie Aluminium. Der Meganeubau wird allein in der Errichtung tausende Tonnen zusätzliches Kohlendioxid emittieren, ein Vielfaches dessen, was für den Erhalt und die Ertüchtigung der Bestandskliniken über deren gesamte Lebensdauer nötig wäre. Die ökologische Bilanz von Megaprojekten ist mithin katastrophal.
Über den Zeitraum des Baus entstehen zwar Arbeitsplätze, aber was sind diese Arbeitsplätze wert, wenn durch sie die stationäre Versorgung verringert und die Umwelt massiv geschädigt wird? Genauso gut kann man den Menschen das Geld direkt geben oder besser noch: sie gut für gesellschaftlich sinnvolle Arbeit bezahlen. Nicht zu vernachlässigen ist auch die erwartbare intensivierte Beanspruchung der MitarbeiterInnen in den Zentralkliniken. Nicht nur müssen die zerschlagenen alten Arbeitsstrukturen mühsam neu aufgebaut werden. Alle bisherigen Klinikleitungen, die mit Neubauten zu tun hatten, haben Personal reduziert und später durch Leiharbeit und Überstunden kompensieren müssen (Beispiel Klinikum Dortmund). Das gilt vor allem bei privaten Krankenhauskonzernen, für die große Zentralkliniken ein Mittel für Einsparungen sind. Außer in Niedersachsen gibt es ein Dutzend Zentralklinikprojekte, vor allem in Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen.
In ganz Deutschland kennt man Ostfriesenwitze. Jetzt zeigt sich, dass die OstfriesInnen, welche die Megaprojekte deutlich ablehnten, sehr klug und vorausschauend sind. Es ist die Landesregierung, die behauptet, etwas würde besser, indem man es kaputt macht. Und weil das in Ostfriesland keiner glaubt, hat man in ganz Niedersachsen Bürgerentscheide zu Krankenhäusern verboten. Damit niemand versucht, es den Ostfriesen nachzumachen – und man ungehindert 40 weitere Kliniken kaputt machen kann.
1 https://www.nwzonline.de/plus-ostfriesland/zentralklinik-uthwerdum-kosten-steigen-400-millionen-architektenwettbewerb-siegerentwurf_a_50,10,1621168447.html abger. 15.6.21; https://www.anevita.de/klinikverbund/zentralklinik/ abger. 25.4.21;
2 siehe Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), geändert am 13.10.2021, https://www.voris.niedersachsen.de.