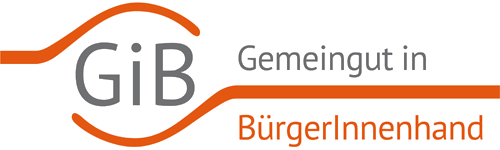„Lieber privat“? – Der Tagesspiegel am 24.3.2012
Von Jürgen Schutte Rekommunalisierung bedeutet grob gesagt die Rückgewinnung des staatlichen Einflusses auf öffentliche Unternehmen und kann viele Gesichter haben. Damit Rekommunalisierung Nutzen für alle bringt, muss sie sorgfältig vorbereitet und umgesetzt werden – unter Beteiligung von BürgerInnen, Beschäftigten, Kommunalpolitikern. Weitere Privatisierungsvorhaben, um das Haushaltssäckel zu entlasten, müssten abgewehrt …